Einmal den gesamten Körper nach versteckten Krankheiten durchleuchten lassen – die Idee klingt verlockend. In den USA erleben Ganzkörper-MRT-Scans als Vorsorgeuntersuchung einen Boom, und auch in Europa bieten erste private Kliniken diese umfassenden Körperscans an.
Befürworter preisen sie als Möglichkeit, Krebs und andere gefährliche Befunde frühzeitig zu entdecken, bevor Symptome auftreten. Sogar Prominente haben den Trend aufgegriffen und öffentlich sogenannte „Full-Body MRI“-Untersuchungen als vermeintlich lebensrettend beworben.
Doch Experten warnen: Die Methode kann mehr schaden als nützen. Was steckt hinter dem Hype um das Ganzkörper-MRT, wie funktioniert es – und welche wissenschaftlichen Daten gibt es dazu? Im Folgenden werden Nutzen und Risiken faktenbasiert beleuchtet – ohne einseitige Bewertung.
Was ist ein Ganzkörper-MRT und warum liegt es im Trend?
Bei einem Ganzkörper-MRT wird der gesamte Körper von Kopf bis Fuß mit der Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht. Der Patient liegt dabei in einer röhrenförmigen MRT-Kamera, während starke Magnetfelder detaillierte Schnittbilder aller wichtigen Organe erzeugen.
Im Gegensatz zur Computertomographie (CT) oder Röntgen kommt die MRT ohne schädliche Röntgenstrahlung aus. Deshalb erscheint sie auf den ersten Blick ideal für wiederholte Vorsorgeuntersuchungen: eine strahlungsfreie Rundum-Untersuchung, die theoretisch beliebig oft wiederholt werden könnte.
Anbieter werben damit, dass ein solcher Ganzkörperscan potenziell „hunderte von Krankheiten“ erkennen kann – von versteckten Tumoren über Aneurysmen bis zu frühen Anzeichen anderer Erkrankungen. In Zeiten von gesteigertem Gesundheitsbewusstsein und biohacking-orientierter Prävention verspricht das Ganzkörper-MRT vielen Menschen zusätzliche Sicherheit und Kontrolle. Auch die weltweite Longevity-Szene ist auf den Zug aufgesprungen. Aber sehen wir uns das noch etwas genauer an.

Erhoffter Nutzen: Was bringt ein Ganzkörper-MRT wirklich?
Die Idee dahinter: Wer einen Tumor im frühesten Stadium entdeckt, hat bessere Chancen auf Heilung. Befürworter argumentieren, dass man durch regelmäßiges Screening Krankheiten erkennen könne, bevor sie Beschwerden verursachen.
Einige Experten schätzen, dass bei etwa 1 % der gescreenten Personen ein bösartiger Tumor entdeckt wird – eine Zahl, die unter anderem von Dr. Gerwin Schmidt in öffentlichen Podcasts genannt wurde. Wissenschaftliche Übersichtsarbeiten zeigen ähnliche Größenordnungen (1).
Einige Studien zeigen auch, dass sogenannte Nebenbefunde wie Aneurysmen, Gefäßverengungen oder unerkannte Entzündungen auffallen können. In Einzelfällen kann das wichtige Hinweise liefern – zum Beispiel auf ein drohendes Hirnaneurysma.
Auch aus Sicht der Longevity-Bewegung scheint die Idee reizvoll: Wer „unter der Haube“ regelmäßig kontrolliert, was im Körper vor sich geht, hofft auf längere Gesundheitsspannen. Doch wie viel trägt ein Ganzkörper-MRT wirklich zur Verlängerung gesunder Lebensjahre bei? Aktuell fehlen belastbare Langzeitdaten.
Wichtige Abgrenzung: Früherkennung ist keine Prävention
Wichtig ist die Unterscheidung: Ein MRT kann Krankheiten früh entdecken, aber sie nicht in der grundsätzlichen Entstehung verhindern. Es handelt sich also um Früherkennung – nicht um echte Prävention.
Echte Prävention bedeutet, Risikofaktoren zu reduzieren, Entstehungsbedingungen zu verändern und die Gesundheit aktiv zu schützen: durch Bewegung, Ernährung, Stressreduktion, Schlafhygiene und gezielte Supplementierung.
Ein MRT erkennt erst dann etwas, wenn bereits eine Strukturveränderung vorliegt. Es ist ein diagnostisches Instrument, kein präventives. Also um diesen wichtigen ersten Schritt zu spät.
Überdiagnosen und psychische Folgen von Ganzkörper-MRTs
Ein zentrales Problem bei bildgebenden Screenings ist die Fehlalarmrate: Studien zeigen, dass rund 15–30 % der gescreenten Personen mindestens einen auffälligen, aber harmlosen Befund haben. Weitere Untersuchungen folgen – oft ohne Ergebnis.
Ein weiterer Aspekt: Überdiagnosen. Gemeint sind Tumoren, die zwar nachweisbar sind, aber nie klinisch relevant geworden wären. Sie wachsen so langsam, dass sie keine Symptome verursachen oder sich sogar spontan zurückbilden. Beispiele dafür gibt es bei Prostatakrebs, Brustkrebs oder Schilddrüsenkrebs. (2)
Besonders deutlich wird das beim Prostatakarzinom: Autopsiestudien zeigen, dass bis zu 59 % der Männer über 79 Jahre einen bislang unentdeckten Prostatakrebs in sich trugen – ohne je Beschwerden gehabt zu haben. Hätte man diese Tumoren durch ein MRT-Screening zu Lebzeiten entdeckt, wären sie womöglich behandelt worden – inklusive möglicher Nebenwirkungen wie Inkontinenz oder erektiler Dysfunktion – ohne echten gesundheitlichen Nutzen. (2)
Hinzu kommt die psychologische Belastung. Menschen mit auffälligen Befunden – auch wenn sie sich später als harmlos herausstellen – leben oft über Monate in Ungewissheit. Angst, Stress, ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper und unnötige Operationen sind mögliche Folgen. Das ist auch einer der Hauptgründe, dass viele Mediziner klar gegen dieses Screen-Tool sind.
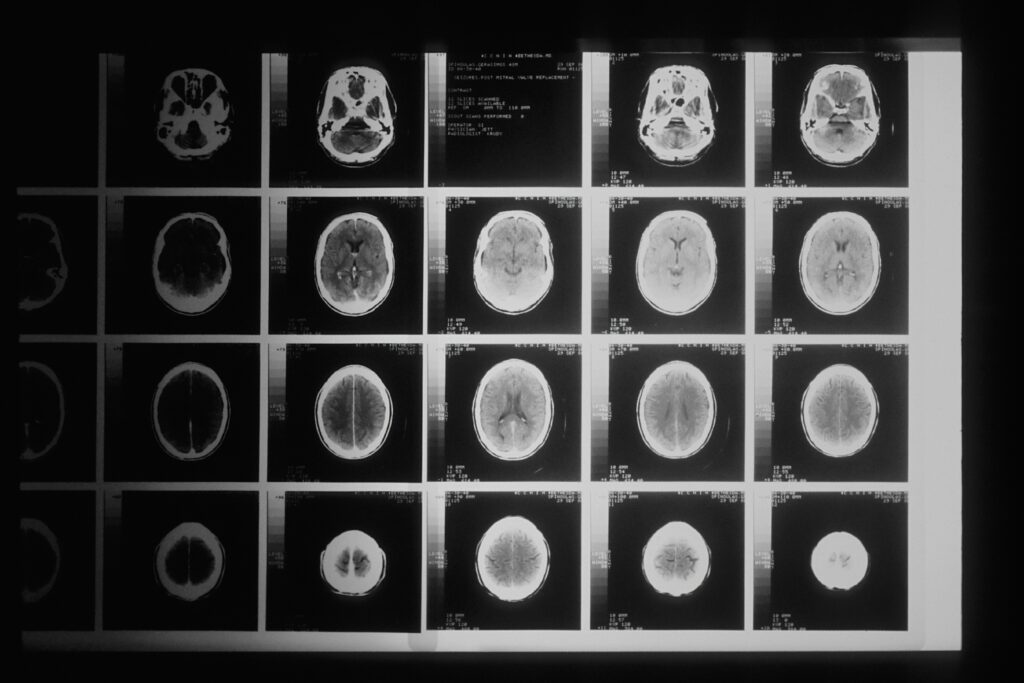
Wirtschaftliche Perspektive: Lohnt sich das Screening?
Ein Ganzkörper-MRT kostet aktuell zwischen 1.000 und 2.500 Euro. Demgegenüber stehen Therapiekosten für fortgeschrittene Tumorerkrankungen, die schnell das Zehn- bis Hundertfache betragen können.
Doch lohnt es sich, die gesamte Bevölkerung ab einem gewissen Alter zu screenen? Wahrscheinlich nicht. Die Rate relevanter Funde ist gering, die Zahl der Folgeuntersuchungen hoch. Gesundheitssysteme müssten enorme Summen investieren – mit fraglichem Nutzen. Alleine die Personalkosten für solche Screens wären enorm und könnten eine staatliche Krankenkasse vollkommen überlasten.
Gesundheitsökonomen sehen flächendeckende Ganzkörper-Screenings daher kritisch.
Was sagen Fachgesellschaften?
Die American College of Radiology (ACR) sowie europäische Radiolog:innen warnen: Es gibt keine belastbare Evidenz, dass Ganzkörper-MRT-Screenings die Lebenserwartung erhöhen oder die Sterblichkeit senken. (3) Für symptomfreie Menschen wird es daher nicht empfohlen. Studien bestätigen diesen Standpunkt. (4)
Für bestimmte Risikogruppen kann ein Ganzkörper-MRT besonders sinnvoll sein. Dazu gehören Menschen mit seltenen genetischen Veränderungen – zum Beispiel einer Mutation im TP53-Gen. Diese Veränderung ist typisch für das sogenannte Li-Fraumeni-Syndrom, bei dem Betroffene ein sehr hohes Risiko haben, schon in jungen Jahren verschiedene Krebsarten zu entwickeln.
In solchen Fällen kann ein regelmäßiges Ganzkörper-MRT helfen, Tumoren sehr früh zu entdecken – oft bevor sie Beschwerden verursachen –, was die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung deutlich verbessert. (5)

Fazit: Faktenbasierte Abwägung statt Hype
Das Ganzkörper-MRT hat Potenzial – aber auch klare Grenzen. Es kann Einzelfällen helfen, bringt aber gesamtgesellschaftlich keine belegte Verbesserung der Gesundheitslage. Es handelt sich um ein Werkzeug zur Früherkennung, nicht zur Krankheitsverhütung.
Wer es einsetzen will, sollte das mit ärztlicher Begleitung tun – und sich bewusst sein, dass auch ein leerer Befund keine Garantie für zukünftige Gesundheit ist. In puncto Longevity ist es vielleicht ein Puzzlestein – aber kein Ersatz für echte Prävention.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Was kostet ein Ganzkörper-MRT?
Die Kosten liegen je nach Anbieter und Umfang zwischen 1.000 und 2.500 Euro. In der Regel ist die Untersuchung eine Selbstzahlerleistung.
Übernimmt die Krankenkasse die Kosten?
In Deutschland übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten nur bei medizinischer Indikation, nicht bei rein präventivem Wunsch. Private Kassen übernehmen überraschend häufig die Kosten für so ein Screening.
Wie lange dauert die Untersuchung?
Ein Ganzkörper-MRT dauert in der Regel zwischen 30 und 90 Minuten – abhängig von der gewünschten Bildqualität und dem technischen Umfang.
Zwar gibt es Schnellverfahren unter 30 Minuten, die von einigen Anbietern als „Express-Scan“ vermarktet werden. Fachleute raten jedoch davon ab, da diese verkürzten Abläufe häufig mit einer geringeren Bildauflösung und eingeschränkter diagnostischer Aussagekraft einhergehen.
Ist das Verfahren gefährlich?
Die MRT ist ein strahlungsfreies Bildgebungsverfahren. Das größte Risiko liegt in Überdiagnosen, nicht in der Technik selbst.
Für wen ist ein Ganzkörper-MRT sinnvoll?
Für Hochrisikogruppen mit erblichen Krebssyndromen kann es sinnvoll sein. Für gesunde Menschen ohne Symptome wird es nicht empfohlen.
Persönliche Leseempfehlungen
Wie du die Gesundheit deines Herz-Kreislauf-Systems messen kanst:
https://richardstaudner.at/2025/05/12/hrv-der-verborgene-rhythmus-deiner-gesundheit/
Wie sinnvoll ist die Messung des Body-Mass-Index?
https://richardstaudner.at/2025/05/11/bmi-was-der-body-mass-index-wirklich-misst-und-was-nicht/
DEXA Scan oder Bioimpedanz? Was taugen die Messmethoden für Körperzusammensetzung wirklich?
Energiegeladene Grüße,
Der Optimizer
Richard Staudner
Wenn dich Themen wie Biohacking, Longevity, Gesundheit und Performance faszinieren, dann ist mein Podcast „Der Optimizer“ das Richtige für dich. Dort findest du regelmäßig neue Folgen mit fundiertem Wissen und praktischen Tipps für deinen Alltag.
Du willst eine Ebene tiefer gehen und direkt mit mir an deiner Gesundheit und Performance arbeiten? Dann schau dir den Performance Club an – mein persönliches 1:1 Coaching-Programm für Menschen, die wirklich etwas verändern wollen.
Hier geht’s zum Performance Club: https://richardstaudner.at/performance-club/
Stress ist aktuell ein Thema für dich? Dann wird dir mein Buch „Drück mal Pause“ helfen, einen neuen Zugang zu mehr Ruhe, Klarheit und Gesundheit im Alltag zu finden. Hier findest du mein Buch auf Amazon: https://lmy.de/ZZvWs
Sources
- Kwee RM, Kwee TC. Whole-body MRI for preventive health screening: A systematic review of the literature. J Magn Reson Imaging. 2019 Nov;50(5):1489-1503. doi: 10.1002/jmri.26736. Epub 2019 Apr 1. PMID: 30932247; PMCID: PMC6850647.
- Bell KJ, Del Mar C, Wright G, Dickinson J, Glasziou P. Prevalence of incidental prostate cancer: A systematic review of autopsy studies. Int J Cancer. 2015 Oct 1;137(7):1749-57. doi: 10.1002/ijc.29538. Epub 2015 Apr 21. PMID: 25821151; PMCID: PMC4682465.
- https://www.acr.org/News-and-Publications/Media-Center/2023/ACR-Statement-on-Screening-Total-Body-MRI
- Ladd SC. Whole-body MRI as a screening tool? Eur J Radiol. 2009 Jun;70(3):452-62. doi: 10.1016/j.ejrad.2009.02.011. Epub 2009 Apr 3. PMID: 19345540.
- Villani A, Tabori U, Schiffman J, Shlien A, Beyene J, Druker H, Novokmet A, Finlay J, Malkin D. Biochemical and imaging surveillance in germline TP53 mutation carriers with Li-Fraumeni syndrome: a prospective observational study. Lancet Oncol. 2011 Jun;12(6):559-67. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70119-X. Epub 2011 May 19. PMID: 21601526.

